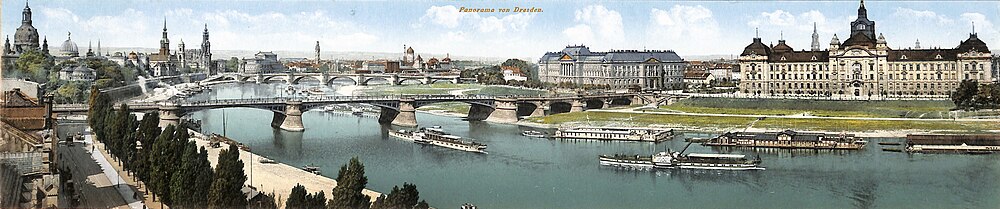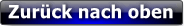Teile der Carolabrücke in Dresden eingestürzt + Historisches
In Dresden
ist am frühen Mittwochmorgen ein großer Teil der Carolabrücke
in die Elbe gestürzt. Betroffen ist laut Feuerwehr der Brückenteil, über den
die Straßenbahnen fahren. Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt liegt in der Elbe
und blockiert die Fahrrinne des Flusses. Wie die Stadt Dresden mitteilte, sind
weitere Brückenteile akut einsturzgefährdet. Wie auf den Bild zu sehen hängt
auch ein zweites Brückensegment durch.
In Dresden
ist eine der wichtigsten Elbbrücken in Teilen zusammengebrochen. Nur 18 Minuten
vorher hatte noch eine Straßenbahn in der Nacht die Querung passiert. Um kurz
nach 3 Uhr stürzten die Schienen ins Wasser. Die Feuerwehr sichert aktuell die
Lage ab. Weil Leitungen beschädigt wurden, ist auch die Fernwärmeversorgung in
der Stadt gestört.
Straßen und
Elberadweg gesperrt
Die
Feuerwehr war gegen 3 Uhr alarmiert worden. Menschen kamen durch den Einsturz
nicht zu Schaden. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Polizei
betonte, es gebe bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der gesamte Bereich
um die Carolabrücke, einschließlich der
Bundeswasserstraße Elbe, des Elberadwegs und des Terrassenufers, bleibt bis auf
Weiteres vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmer
müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Durch den Einsturz fällt mit der
B170 über die Elbe eine wichtige Verkehrsverbindung weg. Es wird gebeten, den
Bereich weiträumig zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.
Fernwärmeversorgung
in Dresden gestört
Wie die
Feuerwehr mitteilte, hatte sich am Brückenkopf auf der Altstädter Seite auf
einer Länge von rund einem Meter ein Spalt gebildet. Darüber hinaus sei es zu
einem Defekt an zwei Fernwärmeleitungen gekommen. Teile des Terrassenufers
wurden unter Wasser gesetzt. Dadurch fiel am Morgen die Fernwärmeversorgung in
der Stadt aus, so die Feuerwehr.
Aktuell
werden die Lage und das weitere Vorgehen sondiert. Dabei kommt an der Elbbrücke
auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz. Beschäftigte der Dampfschifffahrt
sichern den Dampfer "Meißen", der nur knapp hinter der eingestürzten
Brücke am Anleger liegt. An den Rändern des abgestürzten Betonteils hat sich
eine starke Strömung gebildet.
Video vom Brückeneinsturz
Sperrkreis und Räumung von Ministerien
Vor den Rückbau-Arbeiten haben die
Einsatzkräfte einen Sperrkreis von 100 Metern um die Carolabrücke
eingerichtet. Es mussten Teile der Sächsischen Staatskanzlei und des
Finanzministeriums geräumt werden, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre kurz nach 19 Uhr. Ein Polizeihubschrauber fliege,
die Beamten kontrollierten, ob der Bereich frei sei. Erst dann sollen die
Bauarbeiten beginnen, zu denen auch kleinere Sprengungen gehören werden.
"Es wird aber keinen großen Knall geben", sagte Klahre.
Allerdings sei unklar, wie das
beschädigte Bauwerk auf die Abrissarbeiten reagiere. "Es kann sein, dass
die Brücke bleibt, wie sie ist. Mit den Arbeiten ist auch das unvorhersehbare Risikio verbunden, dass Teile oder die ganze Brücke
runterstürzen."
Ticker zur Carolabrücke:
Bundeswehr schickt Bergepanzer
13. September 2024, 15:16 Uhr
In Dresden
ist ein Teil der Carolabrücke eingestürzt. Aktuell
laufen Abrissarbeiten am kaputten Brückenteil. Die Trümmer müssen weiter
zerlegt und abtransportiert werden. Straßen und Teile des Elbufers bleiben
gesperrt.

Sorry Bild
im Regen vom 13.09.2024 gegen 12.30
Bild vom 18.09.2024 gegen 14.30

Zu instabil: Damm für Abriss der Carolabrücke geplant | MDR ...
2016


Historisches
1910
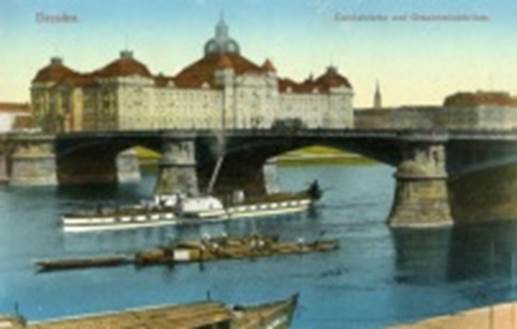
Erste Carolabrücke
(1892–1945)
 Erste Carolabrücke im Jahr
1895 in Richtung Neustadt
Erste Carolabrücke im Jahr
1895 in Richtung Neustadt
Die erste
Brücke wurde nach Vorplanungen von Karl Manck (†
1888) in den Jahren von 1892 bis 1895 unter Hermann Klette errichtet. Das
insgesamt 340 Meter, nach aktuelleren Angaben 326 Meter, lange Bauwerk war
mit 16 Meter Breite für eine 9,6 Meter breite Fahrbahn mit einer
zweigleisigen Straßenbahntrasse und beidseitige 3,2 Meter breite Gehwege
ausgelegt. Die Brückenkonstruktion hatte in der Elbe zwei Strompfeiler und drei
Stromöffnungen. Jeweils sechs vollwandige eiserne
Bögen überspannten die Stromöffnungen bei Spannweiten von 61,0 Meter im
mittleren Bogen und 59,0 Meter in den beiden benachbarten Bögen und einem
geringen Pfeilverhältnis von nur etwa 1:14. Im Vorlandbereich hatte sie am
linken Flussufer zwei und auf der anderen Seite vier gemauerte
Gewölbeöffnungen.
Am Abend des
7. Mai 1945, einen Tag vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland,
sprengten Soldaten der Waffen-SS zwei der drei Stromöffnungen und zwei rechtselbische Vorlandbögen vor der vom Albertplatz
vorrückenden Roten Armee. Wegen der starken Zerstörung wurde auf einen
Wiederaufbau in alter Form verzichtet. Anfang 1952 wurden weitere erhaltene
Teile abgebaut. Am 7. März 1952 wurden die verbliebenen stählernen Bogenträger
gesprengt und die Stahlteile anschließend aus der Elbe geholt.[2]
Die beiden Strompfeiler wurden erst beim Bau der zweiten Carolabrücke
Ende der 1960er Jahre entfernt.
Gesamtansicht
der Brücke um 1910
Zweite Carolabrücke (seit
1967)
Ehrgeizige Stadtentwicklungsprojekte für die Dresdner Innenstadt,
Industrieerweiterungen und forciertem Wohnungsbau waren Anfang der 1960er Jahre
die Grundlage, eine großzügige „Nord-Süd-Verbindung“ zwischen dem damaligen
„Platz der Einheit“ (heute wieder Albertplatz) und dem Hauptbahnhof zu planen,
so der Bausachverständige für Statik und Konstruktion von Brücken und Fachautor
Erich Fiedler in den „Dresdner Heften“ (Nr. 94, 2/2008). Dass diese Planung
einer „Nord-Süd-Verbindung“ an nationalsozialistische Planungsvorstellungen von
1938/1939 anknüpft, erwähnt der Autor allerdings nicht. Auch berücksichtigt der
Autor nicht, dass es zur Innenstadt bzw. zur Nord-Süd-Verbindung bereits 1950
und 1951/52 städtebauliche Ideenwettbewerbe gegeben hat, die letztlich den bzw.
die Brücken vorwegnahmen.
Für den alten Standort der Carolabrücke wurde 1965
ein Wettbewerb ausgeschrieben, da es in der Planungsphase verschiedene
Varianten gab. Eine davon, 1963 vom ehemaligen Chefarchitekten Herbert
Schneider entworfen, sah eine Schrägseilbrücke mit einem Pylon von etwa 90
Meter Höhe vor. Wie schon bei der ersten Brücke wurde eine flache Ausführung
mit wenigen Hindernissen für die Schifffahrt gefordert, weswegen der Altstädter
Strompfeiler entfallen sollte. Straßenbahn- und Autoverkehr sollten durch
Sicherheitsstreifen getrennt werden. Nach zähen Diskussionen entschied man sich
jedoch für ein niedriges Bauwerk ohne hohe Trägermasten und ähnliches, welches
den freien Blick auf die berühmte Elbsilhouette nicht beeinträchtigt.
Gewinner des Wettbewerbes 1965 waren der Ingenieur Eckhart Thürmer und sein Mitarbeiter Willi Spoelgen
vom Projektierungsbüro Straßenwesen Dresden. Spoelgen
ging jedoch 1966 in die Bundesrepublik Deutschland, so dass ein zweiter Entwurf
notwendig wurde. Er entstand wiederum unter Leitung von Thürmer
unter Mitarbeit der Architekten Rolf Berger und Michael Franke als Kollektiv.
Gleichwohl wurden die 1966 von ihnen, einschließlich von Willi Spoelgen entwickelten Ideen im Jahr 1968 vom Patentamt der
DDR unter der Patentnummer 54390: Hohlplatte bzw. Hohlkasten, insbesondere
für Massivbrücken registriert.
1967 bis 1971 wurde dann nach den Vorgaben eine Spannbetonbrücke mit drei
getrennten Überbauten für die Straßenbahn und für jeweils eine zweispurige Richtungsfahrbahn
mit sieben Meter Breite errichtet, wobei die Bauhöhe der Brücke mit
unterschiedlichen Stützweiten von 44 bis 120 Metern relativ gering und eine
fugenlos durchlaufende Konstruktion auf Grund der Biegemomente nicht möglich
war.
Bau und Beschreibung (Zustand von Eröffnung 1971 bis
Teileinsturz 2024)
Die Brücke hat eine (gemittelte) Gesamtstützweite von 375 Metern, ist 32
Meter breit und besteht nebeneinander aus drei „Überbauten“ (in Stromrichtung
der Elbe sind dies fachlich die Brückenzüge A bis C). Es sind Spannbeton-Hohlkastenbrücken
mit Gerberträger und drei Gelenken als Bauwerkssystem in Längsrichtung. Bei nur
noch einem Strompfeiler betragen die Stützweiten im südlichen Randfeld 44 Meter und beim ersten Innenfeld 58 Meter. Die
Elbe wird mit 120 Meter und 95 Meter überbrückt, das nördliche Randfeld spannt 58 Meter weit.
Um bei allen drei Brückenzügen eine gleichmäßige Durchbiegung zu erreichen,
sind diese etwas südlich des Strompfeilers bei dem Gelenkpunkt mit einem
Querträger verbunden. Die über dem Strompfeiler gevoutet
ausgebildete Brücke war in der DDR die Spannbetonbrücke mit der größten
Stützweite. Die kleinste Durchfahrtshöhe beträgt 6,61 Meter beim höchsten
schiffbaren Wasserstand. Die Pfeiler und Brückenköpfe wurden mit Meißner Granit
verkleidet.
Konstruktion und Bau
Anders, als heutzutage üblich, war zu DDR-Zeiten in den 1960er und den
1970er Jahren keine komplette Bauausführungsplanung vor Baubeginn üblich. Nach
einer Grundsatzentscheidung, die je nach Bedeutung eines Bauwerkes örtlich oder
überörtlich zu treffen war, wurden die Einzelfallentscheidungen ausschließlich
durch die beauftragten ausführenden Betriebe getroffen.[14] So
auch für die Elbquerung der „Nord-Süd-Verbindung“, der heutigen Carolabrücke. Ausgeführt wurde das Bauwerk von 1967 durch
den „VEB Brückenbau Dresden“, später Betriebsteil des gebildeten „VEB
Autobahnbaukombinat Magdeburg“. Oberbauleiter war ab 1968 Witlof
Riedrich.
Als erster der drei Brückenzüge wurde beginnend ab 1968 der elbabwärts
gelegene und 2024 eingestürzte Brückenzug errichtet. Eine durchgehende
Spannbetonbrücke zu errichten, war auch durch die geringe Höhe des Überbaus von
1,60 bis 5,30 Metern nicht möglich, so dass diese in einzelne Abschnitte
unterteilt wurde, um auch die Momentenbeanspruchung
im Bereich der Stromöffnung von 120 Meter Länge zu begrenzen. Diese Lösung
bestand darin, dass mit Gerberträgern gearbeitet wurde und insgesamt drei
Gelenke eingebaut wurden. Danach besteht die Hauptöffnung von 120 Metern
Spannweite aus den Kragarmen auf Altstädter Seite mit 12 Metern Länge und auf
Neustädter Seite mit 44 Metern Länge sowie einem Einhängeträger mit 64 Metern
Länge. Damit wurde für den Bau auch eine sinnvolle Teilung in Längsrichtung
möglich. Die drei getrennten Brückenzüge wurden schließlich durch einen –
südlich des Strompfeilers D und knapp nördlich von Gelenk II angebrachten –
Stahlbeton-Querträger miteinander als eine Art „Zwangskopplung“ verbunden, was
die Durchbiegungen in allen drei Brückenzügen weitgehend ausgleicht.
Jeder Brückenzug ruht auf zwei Widerlagern und vier Pfeilern, die in der
Planung den Brückenachsen A bis F zugeordnet wurden. Das Widerlager am
Altstädter Elbufer steht in Achse A, es folgen die Pfeiler in den Achsen B bis
E und zuletzt das Widerlager in Achse F am Neustädter Ufer. Ebenso werden die
drei sogenannten „Gerbergelenke“, an der Altstädter Seite beginnend, mit I bis
III nummeriert.
Als „bemerkenswert“ stellt Fiedler die Ausbildung der Gerbergelenke, also
die drei jeweiligen Brückenauflagen der Gerberträger dar: Die
ineinandergreifenden Gelenke aus Stahlguss sind mit je 14 Koppelbolzen
unmittelbar an Stegspannglieder angeschlossen worden. Er führt weiter aus, dass
„die Vorspannkräfte in den Koppelbolzen der Gerbergelenke eine wichtige
Voraussetzung für die Standsicherheit der Brücke“ sind. Für den Bau und das
Langzeitverhalten der Brücke sei es wichtig, zuverlässige Aussagen über die
Größe dieser Koppelbolzenkräfte zu erhalten. So sind an 121 dieser Gelenkbolzen
Messstellen angebracht, an denen in den Jahren 1974, 1979, 1982 und 1993 die
Zugkräfte gemessen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass keine Gefahr für das
Bauwerk besteht, „wenn auch ein Nachspannen bei einzelnen Gelenken nicht
ausgeschlossen werden kann. Die Gebrauchsfähigkeit des Bauwerkes wird durch
diese Korrekturen nicht beeinträchtigt“ (Fiedler, 2008).
Von 1968 bis 1969 wurde an der Altstädter Elbseite der Überbau des
Brückenzuges C hergestellt, der über den zweiten Pfeiler in Achse C 12 Meter
hinausragte. Mit Hydraulikpressen erhielten die eingebauten Bündelspannglieder
jeweils eine Spannkraft von 1000 kN.[19] Etwas
zeitversetzt, aber insgesamt parallel dazu entstand das insgesamt 149 Meter
lange Neustädter Pendant, das zwischen Strompfeiler in Achse D und dem
nächstgelegenen Pfeiler in Achse E auf der Neustädter Seite 95 Meter weit
spannte und vom Strompfeiler aus noch 44 Meter in Richtung Altstadt über die
Elbe sowie 10 Meter von Pfeiler in Achse E in Richtung Neustadt hinausragte.
Somit verblieb eine Lücke von 64 Meter zwischen den Pfeilern in den Achsen D
und C, die zunächst durch ein Traggerüst über der Elbe geschlossen wurde und
auf dem das sehr schlanke und 600 Tonnen schwere Mittelteil, der
Einhängeträger, betoniert wurde. Als dieses 1970 auf die beiden Gerbergelenke
abgesenkt werden sollte, bestand die Gefahr, dass sich der Neustädter Kragarm beim Einpassen nach oben wölbt. Dem begegnete man,
wie Riedrich ausführte, indem der Balken mit 300
Tonnen Split ballastiert wurde. Abgesenkt wurde es mit Hilfe von
Hydraulikpressen und passte auch exakt.[15]
Unmittelbar nach Herstellung der Brückenteile des Altstädter und des
Neustädter Ufers wurden die Gerüste stromaufwärts verschoben und zunächst der
mittlere Brückenzug B errichtet. Anschließend folgte nach dem gleichen
Procedere der stromauf folgende Brückenzug A. Gleiches galt dann für die
dortigen Einhängeträger. Bei deren Einbau wurde allerdings die Neustädter Seite
nicht beschwert, sondern Spundwände in die Elbe gerammt, um die auskragenden
Neustädter Brückenteile mit Spannstählen zu verankern. So konnten sie sich
nicht nach oben wölben. Noch während der Bauzeit entstand erheblicher
Termindruck. So wurde 1969 zum Drei-Schicht-Betrieb übergegangen.
Eine weitere Herausforderung war die Verlegung der Straßenbahngleise auf dem
Brückenzug C. Da der Brückenzug so schlank war, konnten sie nicht in einem
Schotterbett verlegt werden. Somit wurde eine neuartige Methodik entwickelt:
Zuerst wurde die Oberfläche mit Epoxidharz beschichtet. Zur Verankerung wurden
dann zunächst Bolzen verwendet. Daraus resultierten erhebliche Probleme, wie Riedrich ausführte, da die Stahlbewehrung des
Brückenkörpers beschädigt werden konnte. Schließlich wurden „Höcker aus
Epoxidharz“ gebaut, auf denen die Schienen lagen – Betonschwellen gab es nicht (und die feste Fahrbahn war noch nicht
anwendungsreif). Diese Höcker mussten äußerst belastbar sein und
millimetergenau aufgebracht werden. Dieses Verfahren war äußerst zeitaufwändig,
da stets Messkontrollen stattfinden mussten.[15] Der
Zeitdruck war schließlich so groß, dass im Winter 1970/71 beheizte Schutzzelte
auf dem Brückenzug C aufgestellt wurden, um die Dichtungen herzustellen und die
Gleise zu verlegen. Ziel war, die Brücke noch vor dem
1971 angesetzten VIII. Parteitag der SED verkehrsbereit zu übergeben.
Am 10. Juni 1971, wenige Tage vor Beginn des Parteitages, erfolgte die
Freigabe für den Verkehr. Benannt wurde die Brücke nach dem früheren
sächsischen Ministerpräsidenten und Dresdner Oberbürgermeister Rudolf
Friedrichs.
Die 1970/71 hergestellten Epoxidharz-Höcker waren Anfang der 1980er Jahre verschlissen (die Straßenbahn hatte inzwischen Beschränkung auf eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h auf der gesamten Brücke erhalten), so dass diese um 1987 gegen Epoxidharz-Würfel ausgetauscht wurden, die eine größere Bauhöhe erlaubten und damit auch eine stärkere Befestigung. Diese wurden dann wegen Baumängeln Anfang der 1990er Jahre erneut ausgewechselt.
Im Jahr 2022 wurde die Carolabrücke wegen ihrer besonderen baugeschichtlichen und technikgeschichtlichen Bedeutung sowie ihrem städtebaulichen Wert unter Denkmalschutz gestellt. Das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen charakterisiert die Brücke im Denkmaltext wie folgt: „Mit seiner ‚schlanken Linie‘ nimmt sich das äußerst imposante Bauwerk aus der Entfernung gesehen zurück und ermöglicht einen ungestörten Blick auf die bedeutenden Architekturzeugnisse im Zentrum der Elbmetropole.Sanierungsmaßnahmen ab 2019
Obwohl sich das Tragwerk der Brücke scheinbar in einem guten Zustand befand, bekennt der Autor Peter Hilbert allerdings: „In Jahrzehnten hat es an der Carolabrücke erhebliche Schäden gegeben.“ Deshalb begannen im November 2019 die Sanierungsmaßnahmen. Zudem sollten die Fahrbahnausstattung und -gestaltung den gegenwärtigen Nutzungsanforderungen angepasst werden. Bei ihr sollten breitere Geh- und Fahrradwege angebaut werden. Der vorhandene Brückenquerschnitt reichte dafür allerdings nicht aus, weshalb die Kappen entsprechend verbreitert werden sollten.
Sie begannen an dem elbaufwärts liegenden (östlichen) Brückenzug A. Dabei kam erstmals Carbonbeton im Großbrückenbau zur Anwendung. Die nichtmetallische Carbonbewehrung in Verbindung mit Beton eröffnete als leichterer und flexiblerer Materialverbund gegenüber dem Stahlbeton neue Möglichkeiten der Brückensanierung. Das Material erlaubte es, den Geh- und Radweg von 3,60 Meter auf 4,25 Meter zu verbreitern. Mit herkömmlichen Materialien wäre das aus statischen Gründen nicht möglich gewesen. In Zusammenarbeit mit der TU Dresden sollte Carbonbeton im Bauwesen etabliert werden. Der Einsatz auf der Carolabrücke war ein Pilotprojekt, das die Vorteile der nichtmetallischen Bewehrung verdeutlichen und Dresden als Innovationsstandort herausstellen sollte. Neben dem Carbonbeton sollte auch der Einbau von Basaltbewehrungen getestet werden. Vorgesehen war, die Brückenkappe des Bogens A von einem Ufer bis zur Brückenmitte mit Carbonbeton und die zweite Hälfte bis zum anderen Ufer mit Basaltbeton zu bauen. Bis Juni 2021 dauerte die Sanierung, und erhielt dabei neben den verbreiterten Kappen auch eine neue Abdichtung und Straßenausstattung sowie einen neuen Fahrbahnbelag. Zudem wurden Schadstellen ausgebessert und die Entwässerung instand gesetzt. Die Kosten für Brückenzug A lagen bei rund sechs Millionen Euro.
Von Oktober 2022 bis Juni 2024 wurde der mittlere Brückenzug B in ähnlicher Weise saniert. Dies musste, anders als bei der ersten Etappe, aufgrund der unterdessen erfolgten Unterschutzstellung denkmalgerecht erfolgen. So erhielt die Außenfläche der Stahlbetonkappen die von unten sichtbare Fläche eine Riffelung, wie bei der alten Brücke.
Von Januar 2025 bis zum ersten Quartal 2026 war die Sanierung des Brückenzugs C vorgesehen, der bei der letzten Hauptprüfung die Bewertung „nicht ausreichend“ (3,0–3,4) erhalten hatte. Vorgesehen war die Erneuerung der Abdichtungen, Stahlbetonkappen, Geländer, Beleuchtung und der Gleistrasse selbst. Ebenfalls stand der Hohlkasten unter der Fahrbahndecke zur Sanierung an, der mit 1,6 bis 5,2 Metern Höhe zum Großteil gut begehbar war. Der Autor Peter Hilbert schreibt am 14. August 2024 darüber: „Dort gibt es viele schadhafte Stellen im Beton mit Hohlräumen und Rissen“, die mit Presslufthämmern abgebrochen werden sollen und schließlich mit Spezialmörtel, wie in den anderen Brückenzügen, erneuert werden sollten.[2] Die Ausschreibung war bereits erfolgt, und wurde nach dem Teileinsturz aufgehoben.[30]
Nach Angaben des Leiters des Instituts für Massivbau der TU Dresden Professor Manfred Curbach wurde die Brücke schon seit vielen Jahren mit einer ständigen Bauwerksüberwachung beobachtet. Auf den bevorstehenden Einsturz deuteten aber keine Messwerte hin.
 Instandsetzungsmaßnahmen
der Carolabrücke im Juni 2020. Zur Verbreiterung der Fußgänger- bzw.
Radwege kommen Fertigteile aus Carbonbeton zum Einsatz
Instandsetzungsmaßnahmen
der Carolabrücke im Juni 2020. Zur Verbreiterung der Fußgänger- bzw.
Radwege kommen Fertigteile aus Carbonbeton zum Einsatz
Hauptprüfung von Brückenzug C 2023
2023 fand die letzte – aller sechs Jahre erforderliche – Hauptprüfung nach DIN 1076 des Zuges C statt. Diese ergab die Note 3,0 auf einer Skala von 1 („sehr guter Zustand“) bis 4 („ungenügender Zustand“). Eine Benotung zwischen 3,0 und 3,4 bedeutet einen „nicht ausreichenden Zustand“. Eine Nutzungseinschränkung ist bei dieser Bewertung nicht zwangsläufig erforderlich. Diese Benotung ist ein Hinweis, dass in nächster Zeit Instandsetzungsmaßnahmen zu planen sind.