Marienschacht und Malakoff-Förderturm
Als Malakow-Turm (auch Malakoff-Turm) werden Fördertürme mit einer
charakteristischen Bauform bezeichnet, die vorwiegend in den 1850er- bis
1870er-Jahren,







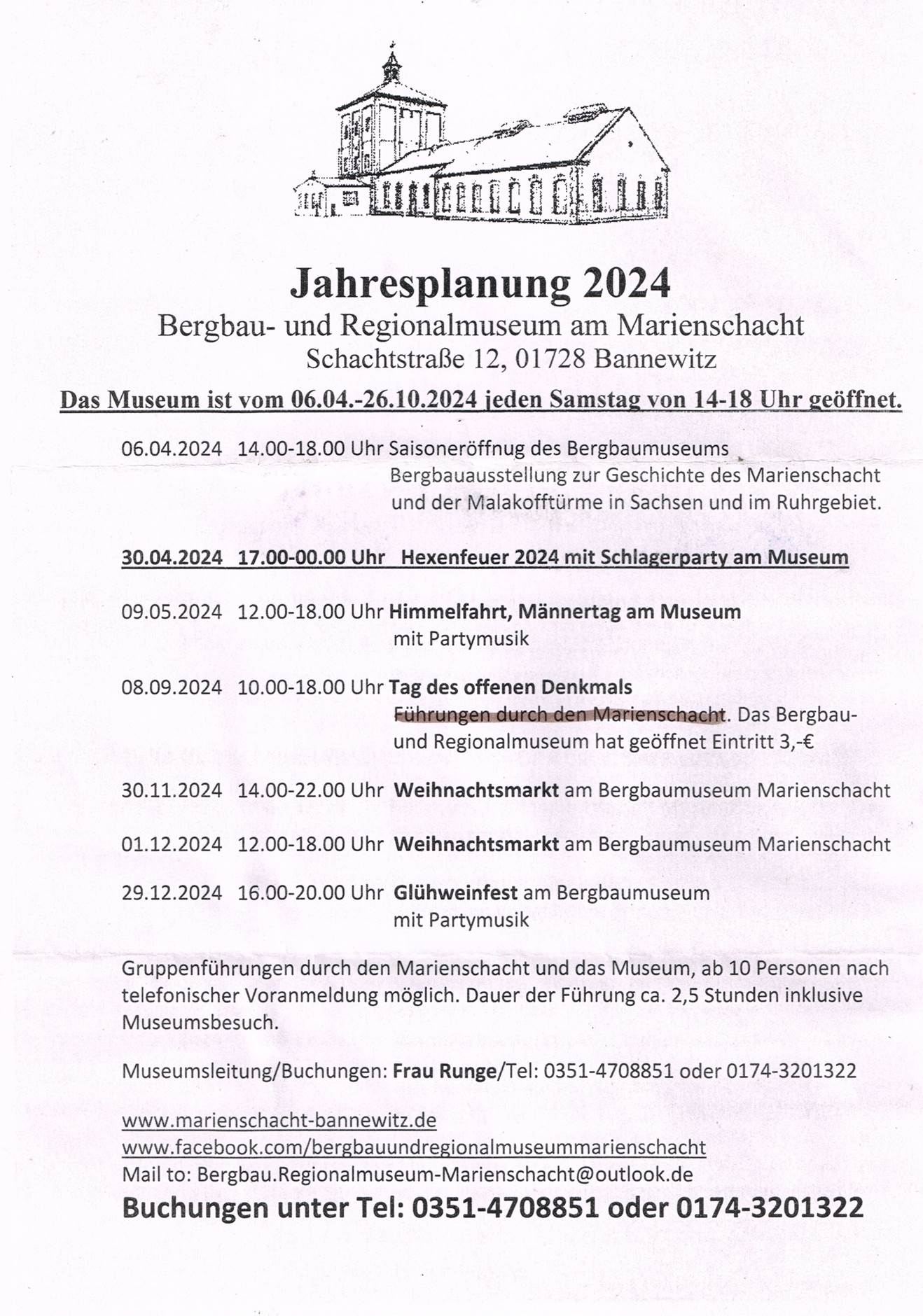
PS. zur Jahresplannung 2024
08.09.2024 10.00-18.00 Uhr Tag
des offenen Denkmals die Führungen fanden statt der Eintritt ist eigentlich
kostenlos
https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/denkmal/4f20a84a-c696-11ea-ab68-960000611c47
Öffnungszeiten Sonntag, 08.09.2024 12:00 - 16:00 Uhr
Über dieses Denkmal
1886 begann der Bau des Schachts, Nutzung bis 1930.
Außerdem einziger noch komplett ausgestatteter Förderturm seiner Art mit
Fördermaschine und Seilfahrteinrichtung.
Dies kann auf obigen Link nachgelesen werden.
Historisches
1886
begann der Bau des Schachts, Nutzung bis 1930. Außerdem einziger noch komplett
ausgestatteter Förderturm seiner Art mit Fördermaschine und
Seilfahrteinrichtung.
Adresse
Schachtstr. 12
01728 Bannewitz
Historisches
1886
12. Juni
Einschlag des Schachtpunktes (Beginn der Teufarbeiten).
Der Querschnitt des Schachtes 6,568 m lichte Länge; 2,888 m lichte Weite. Der
Ausbau erfolgt mit einer 37 cm starken Ziegelmauer. Bis Jahresende betrug der Teuffortschritt 40m. Durchteuft wurden 4,3m in der Diluluvial 11,3 m in Quadersandstein 24,4 m in der
Formation des Rotliegenden. Wegen starker Wasserzugänge musste am Jahresende
der Teufbetrieb eingestellt werden. Bei der Firma Hülßenberg mussten zwei neue Dampfpumpen bestellt werden.
1887
Mitte
Februar Wiederaufnahme der Teufarbeiten. Ende Mai
wieder eingestellt. Bei 44,5 m Teufe erreichten die Wasserzugänge 2m³ in der
Minute. In den Gemeinden Bannewitz, Welschhufe und Eutschütz fielen
die Brunnen trocken. Neue Brunnen mussten durch die Freiherrlich von Burger
Steinkohlenwerken angelegt werden. Anfang August konnten,
nach dem die Wassermassen zurückgegangen waren, die Teufarbeiten
fortgesetzt werden.
1888
Zwischen 63
und 80 m wurden trockene Schieferton und Konglomoratschichten
durchsunken. Zwischen 87 und 104 m tritt aus den
Spalten des Rotliegenden 1,3 m³ Wasser in der Minute aus. Zur Wasserhaltung
sind 2 Pulsometer und die zwei neuen Hülsenbergschen
Dampfpumpen im Einsatz.
1889
Weitere
Teufe bis 175 m. Von Meter 73 bis 125 wurde wasserdichte Ausmauerung
eingebracht. Bei 160 m Teufe wurde trockenes Gebirge erreicht.
1900
Durch die
Firma Göhmann und Einhorn aus Dortmund wird im ersten
Stockwerk des Treibehauses ein Brausebad mit 18
Brausen für die erwachsenen und 3 Brausen für die jugendlichen Arbeiter
eingebaut. Weiterhin wurden 200 Kleideraufzüge aufgehängt. Diese Anlagen wurden
nicht durch alle Arbeiter genutzt.
1901
Umfangreiche
Untersuchungen zur Feststellung der Baufeldgrenzen begannen. In östlicher
Richtung bei 750 m vom Schacht vertauben die Kohlenflöze. Weiterhin werden in
Richtung West und Nord durch die Baufelder „Glück auf“ Schacht, „Potschappelaktienverein“ und „Gitterseer
Aktienbauverein“ Grenzen gesetzt.
1901
Umfangreiche
Untersuchungen zur Feststellung der Baufeldgrenzen begannen. In östlicher
Richtung bei 750 m vom Schacht vertauben die Kohlenflöze. Weiterhin werden in
Richtung West und Nord durch die Baufelder „Glück auf“ Schacht, „Potschappelaktienverein“ und „Gitterseer
Aktienbauverein“ Grenzen gesetzt.
1903
Der Rückbau
beginnt. Auf ca. 350 m Länge wird der neue Strebbau angewendet.
1904
An der
Wetterverbindungsstrecke nach „Glück auf“ Schacht wird gearbeitet. Der durch
den roten Ochsen hervorgerufene Flözsprung beträgt
122,5 m.
1905
Die Anzahl der
Kleideraufzüge und Duschen musste zum zweiten mal erhöht werden, da die Bergleute von „Segen
Gottes“ Schacht die Kaue mit benutzten.
1906
Mitte des
Jahres erfolgte der Durchschlag der Wetterstrecke nach „Glück auf“ Schacht.
1910
Werkzeugmaschinen
werden nach "Glück auf" Schacht umgesetzt. Es erfolgt ein größerer
Einsatz von Bohrhämmern der Firma Spockhövel in der
Grube.
1911
Gleiswaage
von 25 t Tragkraft und Rangierseilzuganlage für die Bahnverladung wurden
eingebaut.
1912
Bau einer
Seilbahn zur Beförderung der Kohlen nach der Wäsche.
1913
Einsatz
einer Hochdruckpressluftlok von 10 PS Leistung, Fülldruck 150 at – Bauart
Mayer. Erster Einsatz eiserner Förderwagen. Durch Untersuchungsbohrungen wurde
eine wesentlich kleinere Fläche an abbauwürdigen Kohlevorräten festgestellt.
1914
Im August
Einstellung des Förderbetriebes wegen Personalmangel. Ausnahme bilden die
Instandhaltung und die Wetterführung. Anfallende Kohlen aus der Instandhaltung
wurden weiterhin bis 1915 nach über Tage verbracht.
1915
Beginn des Abbruchs
der 1914 stillgelegten Koksofenanlage.
1918
Aufstellung
eines Sägegatters.
1920
Das
Bergarbeiterkrankenhaus des Freiherrlich von Burker
Steinkohlenwerkes wird wegen zu hoher Kosten aufgegeben. Die Behandlung von
Kranken und Verletzten erfolgt in Johannstadt.
Einführung elektrischer Signaleinrichtungen am Schacht.
1921
Wieder volle
Förderung.
1926
Versuchsweiser
Einsatz einer Schrämmaschine, auf Grund der harten Kohle blieb der Versuch
erfolglos.
1927
Der Kohleabbau
erreicht den Schachtsicherheitspfeiler an seiner südlichen und östlichen
Grenze. Die Förderung wird seit September nur noch in zwei Schichten
durchgeführt.
1928
Die gesamte
Fördermenge an Kohle wird über die 1927 errichtete Gleisseilbahn der Zentralwäsche
des „Glück auf“ Schachtes zugeführt. Die Länge der Seilbahn beträgt von Schacht
zu Schacht 780 m. Die Seilbahn führt über zwei Brücken und durch einen Tunnel
von 340 m länge. Die Trockenaufbereitung und die
Wäsche werden stillgelegt. Der Bahnversand wird ebenfalls eingestellt. Die
Abbrucharbeiten der genannten Anlagen beginnen.
1930
1930 Der
Werksbetrieb wird am 31. März eingestellt, der Schacht bis 223 m unter
Hängebank verfüllt. Die gesamte Anlage wird für neue Nutzer bereitgestellt.
1959
Die Schachtanlage
wird für die Nutzung durch den VEB Steinkohlenwerk Freital aufgewältigt.
1993
Der Schacht
wird endgültig verfüllt, die Haldenanlagen saniert und für Nachnutzer bereit gestellt. Die gesamte Fördereinrichtung bleibt
erhalten und steht mit dem Gebäudekomplex unter Denkmalschutz.